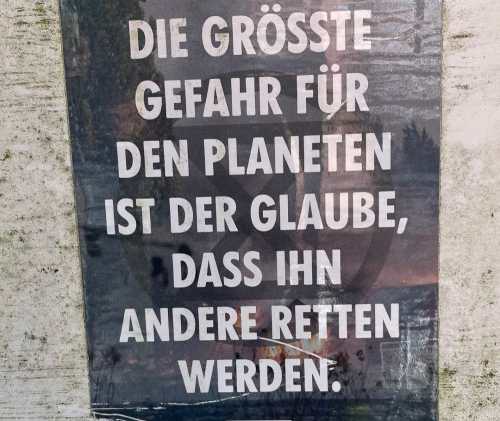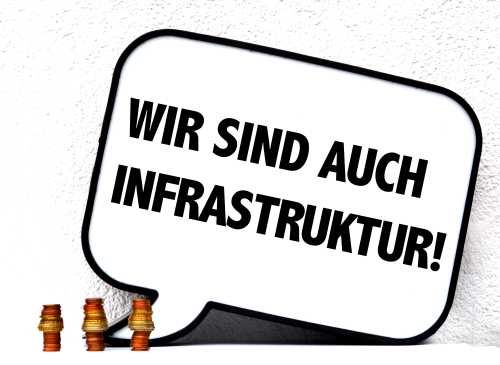Gras oder grässlich?
Januar und Februar 2026 – das waren seit vielen Jahren einmal keine November 2.0 und 3.0 sondern Wintermonate im klassischen Sinne: Mit geschlossener Schneedecke und lange anhaltendem, teils sogar strengem Frost. Jetzt, wo Schnee und Eis im Tiefland sogar mehrfach getaut sind bzw. auch zwischendurch wahlweise weggeregnet wurden, ist allerdings abseits der Blumengeschäfte noch immer kein Frühlingserwachen in Sicht.

Straff oder schlaff? Strukturbildende Gräser
vertragen Schneelast und Winternässe nicht gleichermaßen gut
Und was da als Garten jetzt wieder zum Vorschein kommt, das ist in den meisten Fällen nicht besonders ansehnlich. Richtig, das winterliche Gartenbild hat eine einzigartige Bildwirkung.
In den allermeisten Fällen ist diese Wirkung aber ganz anders als in auch ohne Schneelandschaft schönen winterlichen Farbpaletten wie sie zum Beispiel in dem tollen Winter-Schokoladenseiten-Bildband ‚Gärten im Winter‘ von Céderic Pollet (Ulmer Verlag) oder auch in unserem Beitrag auf der Webseite zur Pflanzenverwendung ‚Winter im Garten? Nicht nur düster und kahl!‘ beschrieben und angepriesen wird.

Klassiker und Preziosen im winterlichen Garten (von oben rechts im Uhrzeigersinn): Cornus alba 'Sibirica' (Rotrindiger Hartriegel), Hamamelis x intermedia 'Diane' (Zaubernuss), Betula jacqueontii (Himalaja-Birke), Cotoneaster-dammeri-Sorte (Zwerg-Kriechmispel) und das langhaftende, kupferfarben verfärbte Laub der Rot-Buchen (Fagus sylvatica) - fehlt nur noch ein Schuss Immergrün in Form von Taxus (Eibe) oder meinetwegen auch Rhododendron ... und wo bleiben die Gräser?
Nicht in jedem Garten leuchtet eine weißrindige Betula utilis ‚Doorenbos‘ oder Betula jacquemontii (s.o., wenn nicht, bitte gleich auf To-Do-Liste ergänzen: Im Frühjahr Betula utilis ‚Doorenbos‘ oder Betula jacquemontii pflanzen!). Trost und Struktur spenden meist Immergrüne und das hoffentlich langhaftende kupferfarbenen Herbstlaub der Rot-Buchenhecken (Fagus sylvatica).
Auch die vielgepriesenen Fruchtstände und Stängel der (vorbildlich!) nicht im Herbst zurückgeschnittenen Stauden sind nach dem Schneeüberzug vielfach zu einem verrottendem Mulchhaufen zusammengesunken.

Präriepflanzung nach dem Abtauen:
Nur die Stängel einiger Asteraceae
(hier: Rudbeckien und Sonnenhut)
stehen noch aufrecht
Doch wie sieht es mit Gräsern aus? Können nicht diese unsere Pflanzungen im Sommer und Herbst um Schwingung, Transparenz und Struktur bereichernde Gestalten auch jetzt im späten Winter optisch und strukturell etwas ‚reißen‘?

Das Japanische Blutgras (Imperata cylindrica ‘Red Baron‘) besticht noch im späten Herbst mit bereiften Blättern und hat die in Norddeutschland letzten milden Wintern überlebt. Ob da aus dem Mulchhaufen (Bild rechts) in diesem Frühjahr irgendetwas austreiben wird?
Ein Blick in den eigenen Garten und in die Gärten in der Nachbarschaft zeigt: Kommt darauf an! Während ‚nur‘ Raureif für zauberhafte Gartenbilder mit allen Gräsern sorgt, sind bei weitem nicht alle Gräser bei Schneelast oder ausgeprägter Winternässe ausreichend standfest.
Bei Überlegungen zur Gräserverwendung kann jedoch nicht nur die Frage „sieht im Winter gut aus/ nicht gut aus“ eine Rolle spielen. Für die Auswahl eines bestimmten Grases können mit Blick auf die Standfestigkeit auch funktionale Gründe bedenkenswert sein.

Bambushalme sind unerhört biegsam. Bei Schneelast lagern die Halme insbesondere der hohen Sorten, einzelne Halme können jedoch auch brechen. Hier werden Bambus im Botanischen Garten Hamburg nach Schneelast ausgeputzt und abgeknickte Halme abgeschnitten. Bild oben rechts: Die niedrigeren Fargesia-Sorten können mit Blick auf Standfestigkeit bei Schneelast und das leidige Thema der Wurzelsperre gegenüber Phyllostachys-Sorten die bessere Wahl sein
So lagern beispielsweise höhere Bambus-Arten und -Sorten (z.B. Phyllostachys-Sorten) bei Schneelast gnadenlos. Nach Entlastung stehen die sehr elastischen Halme zwar überwiegend wieder straff aufrecht – aber eben nur überwiegend.
Nach eigener Beobachtung knicken einzelne Halme tatsächlich ab oder bleiben auf Halbmast. Diese Halme sollten dann sinnvollerweise abgeschnitten werden. Das Lagerungsproblem bei Schneelast ist vor allem bei größeren Bambushorsten oder Bambushecken nicht zu unterschätzen: Die Inanspruchnahme einer erstaunlich großen Fläche durch die langen niedergedrückten Halme kann Wege versperren oder dazu führen, dass sich Halme (was erlauben Bambus!) auf Nachbargrundstücke niederlegen.
Da hilft dann nur das regelmäßige Abschütteln der Schneelast – bzw. bereits bei der Pflanzenauswahl die Waahl standfesterer, niedrigeren Arten wie Fargesia – die als horstbildende Arten sogar eine Rhizomsperre enbehrlich machen.

Höhere Gräser in Reihe gepflanzt können als halbtransparente Hecken Gartenbereiche gliedern oder Terrassenflächen locker abschirmen und abgrenzen. Chinaschilfe sind bei schneereichen Wintern nach den Erfahrungen aus dem Winter 2025/ 2026 die sicherere Wahl gegenüber dem Garten-Reitgras, das zumindest in Teilen nach Schneelast auf dem Boden liegen bleibt
Ein weiteres Beispiel für Fragestellungen nach der Funktionalität einer Gräserpflanzung bei der Pflanzenauswahl ist das viel verwendete Garten-Reitgras (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster‘) und weitere Calamagrostis-Sorten.
Das Gras zeichnet sich durch seine bis in den Herbst/ Winter straff aufrecht stehende und bei ausreichend sonnigem Standort für gewöhnlich standfeste Halme aus. Kunststück, dass dieses strukturstarke Gras so gerne verwendet wird, das als Kaltsaisongras auch noch mit frühem Austrieb punktet. Als halbtransparente Gräserhecke geplant und gepflanzt, kann die erhoffte Trenn- und Gliederungsfunktion nach Schneelast nach Beobachtungen in diesem Jahr jedoch durch überwiegend umgeknickte Halme verloren gehen.
Im Bildbeispiel oben wurden Calamagrostis großflächig als Gräserhecke auf einen Erdwall gepflanzt, um den Einblick in die dahinterliegenden Gärten und Wohnzimmer zu verringern: Diese Funktion kann nun nach Schneefall für den Rest des Winters nicht mehr erfüllt werden.
Kommt es auf die Abschirmfunktion hauptsächlich während der Garten- bzw. Terrassensaison an, dürfte dies jedoch verschmerzbar sein. Wenn nicht, kann der Griff zu einer nicht zum Abknicken neigenden Chinaschilf-Sorte die bessere Wahl sein – mit dem Nachteil des späteren Neuaustriebs im Frühjahr.

Bild links: Winterschutz der Horste von Cortaderia selloana mit Reisig im Botanischen Garten Hamburg, Bild rechts: Zusammengebundenes Chinaschilf oder doch ein Langhaarmonster im Regen?
Ein Behelf gegen auseinanderfallende Pflanzen ist das Auf- bzw. Zusammenbinden der Halme. Ob derartige Gestalten das winterliche Gartenbild wirklich bereichern oder eher der Eindruck von in-den-Regen gekommenen Langhaarmonstern entsteht: Das überlassen wir der Geschmacksache.
Standfest und mit guter Winterstruktur
- oder nicht?
Vereinfacht aus Beobachtungen in der Nachbarschaft Ende Januar bis Mitte Februar 2026 und ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder anderslautende Erfahrungen sollen Gräser mit Blick auf die Winterstandfestigkeit (Schnee/ Nässe) in drei Gruppen eingeteilt werden:
Gruppe 1:
Nicht standfeste Gräser nach Winternässe und Schneelast
Gräser aus dieser Gruppe eignen sich nach Schneelast oder Winternässe nicht als winterliche Strukturbildner:

Gruppe 1 mit nicht standfesten Gräsern (von links oben im Uhrzeigersinn): Calamagrostis varia, Hakonechloa macra 'Aureola', Imperata cylindrica 'Red Baron', Molinia arundinacea, Molinia caerulea
- Calamagrostis varia (Berg-Reit-Gras): Nach Schneefall platt daniederliegend
- Hakonechloa macra ‘Aureola‘ (Japan-Goldbandgras): Liegt es am Standort? Im Gegensatz zur Art (Gruppe 3) war vom Fotomodell (s.o) nach dem Abtauen der Schneedecke statt Goldband nur noch feuchter Mulch übrig
- Imperata cylindrica ‘Red Baron‘ (Japanisches Blutgras): Nach Winternässe und Schneelast bleibt nur noch matschiger Mulch
- Molinia caerulea und Molinia arundinacea und Sorten (Pfeifengräser): Strukturstark und standfest bis in den Herbst, nach Schneelast und bei Nässe leider komplett flachliegend
Gruppe 2:
Mäßig standfeste Gräser mit eher wenig attraktiver Struktur nach Winternässe und Schneelast
Arten aus dieser Gruppe sind wenig standfest und zeigen nach Schneelast/ Nässe zwar wenig (höhere/ straffe) Struktur, machen aber auch nicht den Eindruck eines nassen ‚Mulchhaufens‘:

Zu Gräsern der Gruppe zwei mit mäßiger Standfestigkeit zählen wir (von oben links im Uhrzeigersinn): Ammophila arenaria, Calamagrostis x acutiflora-Sorten, Cortaderia selloana, Deschampsia cespitosa-Sorten, Leymus arenarius und Panicum virgatum in Sorten
- Ammophila arenaria (Strandhafer), Strandhaferflächen im sind im Winter niederliegend teils in ungeordneten Grasschopf-Haufen, die bei flächiger Verwendung aber die Fläche gut bedecken
- Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster‘ und weitere Sorten (Reitgräser): Ohne große Schneelast überdauern die straffen Stängel der Reitgräser die Vegetationsruhe bis zum zeitigen Rückschnitt im Frühjahr – mit Schneelast jedoch nicht sicher bzw. teils-teils
- Calamagrostis brachytricha (Diamantgras): Mehr oder weniger zusammengesunkene Grasschöpfe
- Cortaderia selloana (Pampasgras): Die großen Grasschöpfe vom hohen Pampasgras sind im Winter strukturstark, benötigen aber ggfs. einen Winterschutz – die charakteristischen wie imposanten Blütenwedel knicken bei stärkerem Schneefall häufig leider ab; dieses Solitärgras gilt bis etwa -10°C als winterhart
- Deschampsia cespitosa und Sorten (Wald-Schmiele): Die horstartigen, wintergrünen Grasschöpfe wirken im Winter ohne die füllig-fedrig-wolkige Anmutung der sommerlichen Blütenstände in der Pflanzfläche ein wenig verloren und sind kaum strukturbildend
- Leymus arenarius (Strand-Roggen, Blau-Strandhafer): Das Gras ist eigentlich wintergrün - oder besser gesagt winterblau. Die typische Blaufärbung ist zumindest in diesem schneereichen und frostigen Winter 2025/26 in Norddeutschland weg. Die Fläche bleibt bedeckt, die verbliebenen, unordentlich wirkenden verblassten Laubhaufen fügen dem Gartenbild jedoch nicht wirklich eine wünschenswerte Struktur hinzu – und sollten, obwohl dieses Gras eigentlich nicht zurückgeschnitten werden muss, im Frühjahr entfernt werden, um den frischen Austrieb freizustellen
- Panicum virgatum in Sorten (Rutenhirse): Hier sind Unterschiede je nach Standort und Sorte zu beobachten: Feinhalmige Sorten mit straffen Stängeln wie ‘Strictum‘ stehen noch aufrecht und gehören in die Gruppe 3 mit guter Winterstruktur, während andere Sorten wie ‘Külsenmoor‘ (oben im Bild untere Reihe links) als Gräserschopf geknickt niederliegend
Gruppe 3
Standfeste und mehr oder weniger strukturhaltende Gräser auch nach Winternässe und Schneelast
Die in diese Gruppe einsortierten Arten scheinen nach dem Verschwinden der Schneedecke und/ oder längeren winterlichen Nässeperioden ausreichend standfest zu sein und zeigen eine mindestens akzeptable bis gute winterliche Struktur in Pflanzungen:


Die Gruppe der ausreichend standfesten Gräser als mindestens akzeptable winterliche Strukturbildner in der Pflanzung ist gar nicht so klein (von oben links im Uhrzeigersinn): Panicum in Sorten, Miscanthus sinensis in Sorten, Cortaderia selloana (niedrige Sorten), Hakonachloa macra, Carex pendula, Carex morrowii C. foliosissima in Sorten, Luzula sylvatica, Sesleria autumnalis, Stipa gigantea, Stipa tenuissima (letzte beide Bilder)
- Carex foliosissima u. Sorten (Teppich-Japan-Segge): Immergrün, wertvoller Bodendecker im winterlichen Garten
- Carex morrowii u. Sorten (Japan-Segge): Immergrün, wertvoller Bodendecker im winterlichen Garten
- Carex pendula (Riesen-Segge): Immergrüne Schöpfe
- Cortaderia selloana in niedrigen Sorten wie ‚Pumila‘ (Pampasgras), einige Gartenexemplare mit ausgesprochen starkem Winterbild trotz Schnee und Nässe, jedoch ggfs. Winterschutz erforderlich
- Hakonechloa macra (Japan-Waldgras): Echte Stehauf-Gräser durch ihre drahtartigen Stengel, auf denen die Blätter für eine lange Zeit gold-strohgelbe Blattfärbung zeigen, bevor sie zum Ende des Winters verblassen
- Miscanthus in Sorten (Chinaschilf): Benchmark für hohe strukturbildende Gräser im Winter, ähnlich gute Winter-Anmutung wie Phragmites-Flächen
- Luzula sylvatica (Wald-Marbel): Das immergrüne Gras ist als verlässlicher Bodendecker in den Lebensbereichen Gehölz/ Gehölzrand wertvoll im winterlichen Garten
- Pennisetum in Sorten (Lampenputzergras): Mehr oder weniger ansehnliche Gräserschöpfe,die aber zumindest nicht platt auf dem Boden liegen
- Sesleria autumnalis (Herbst-Kopfgras): Die Blütenstände sind lange weg, aber die wintergrünen Gräserhorste stehen auch nach Schneelast stabil
- Stipa gigantea (Riesen-Federgras): Die typischen hoch über der Basis schwebenden Blütenrispen sind natürlich längst zusammengeknickt, der wintergrüne graugrüne Gräserhorst steht aber durchaus strukturstark in der Pflanzfläche
- Stipa tenuissima, Stipa ‘Pony Tails‘ (Federgras): Federgräser zählen zu den Gräsern, die normalerweise nicht zurückgeschnitten werden. Flächig gepflanzt wirken die Flächen durch einzelne platt gedrückte Pflanzen zwar etwas durcheinander – insgesamt bietet dieses Gras aber durchaus eine noch akzeptable winterliche Struktur
Aus gärtnerischer Sicht sind natürlich auch die nicht so standfesten Gräser weder Drama noch Problem: Denn je nach Witterung und Lust auf Gartenarbeit werden die allermeisten Gräser ab etwa Mitte Februar bis Anfang März ohnehin zurückgeschnitten - auch, um für die Zwiebelblühern die Bühne zu räumen.
Funktioniert gut: Narzissen (hier: Top-Sorte 'Ice Follies', Blüte ab etwa Ende März) beleben die Pflanzplätze der bereits zurückgeschnittenen hohen Miscanthus, die mit ihrem Neuaustrieb wiederum die abgeblühten Narzissen kaschieren
Wenn Sie sich jetzt fragen: Welche Zwiebelblüher - dann kramen Sie noch einmal die To-Do-Liste hervor, auf der schon die Himalaja-Birke steht. Ihre Baumschule Bradfisch erfüllt Ihnen im nächsten Herbst auch sehr gerne Blumenzwiebelwünsche ;-)
Veröffentlicht in Pflanzen, Pflanzenverwendung am 16.02.2026 19:00 Uhr.